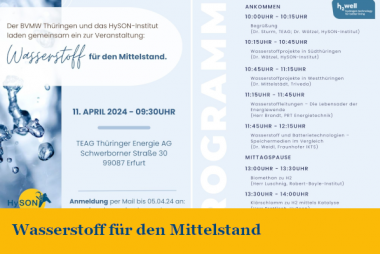Zerlegung von Ammoniak
Zerlegung von AmmoniakForschungsvorhaben zum Energieträger einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft
 Grüner Kalk
Grüner KalkForschungsvorhaben zur Entwicklung eines Verfahrens zur effektiven CO2-Abscheidung und -Nutzung für die Kalkindustrie
 Modernisierung der Infrastruktur
Modernisierung der InfrastrukturForschungsvorhaben zur Entwicklung eines innovativen Beschichtungsverfahrens für bestehende Leitungsnetze
 Elektrolyseprodukte für die medizinische Anwendung
Elektrolyseprodukte für die medizinische AnwendungForschungsvorhaben für Herstellung von reinem Sauerstoff als Elektrolyseprodukt
 FlyHy – Wasserstoffbasierte Drohne mit Wechselträgerkonzept
FlyHy – Wasserstoffbasierte Drohne mit WechselträgerkonzeptForschungsvorhaben zur Entwicklung einer wasserstoffbetriebenen Drohne mit universellem Werkzeugwechselsystem
 GreatH2 - Green Hydrogen for industrial applications in Thuringia
GreatH2 - Green Hydrogen for industrial applications in ThuringiaPotentialanalyse für grünen Wasserstoff in Thüringen für den Aufbau von Demonstrationsprojekten

 Marktfähige Wasserstofftankstelle
Marktfähige WasserstofftankstelleMit On-Site-Elektrolyse für die Betankung von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb
 Optimierter Klärprozess
Optimierter KlärprozessLeistungssteigerung von bestehenden Kläranlagen mittels Sauerstoff
HySON – Wasserstoffforschung in Thüringen
Am HySON-Institut wird die praxisnahe Anwendung von H2-Technologien erforscht. In der Entwicklung und Erprobung von Wasserstofftechnologien nimmt der Institutstandort Sonneberg eine Vorreiterrolle ein, zumal hier bereits eine bestehende H2-Infrastruktur in der Praxis erprobt und Synergien untersucht werden.
HySON-Institut
Das HySON-Institut will die Entwicklung von Wasserstofftechnologien, Wasserstoffsystemen und den entsprechenden Infrastruktureinrichtungen voranbringen und den Technologietransfer mit Modellen für den praktischen Einsatz aktiv mitgestalten. Das Insitut schließt die Lücke zwischen Forschung und Anwendung in Thüringen.
Forschungsschwerpunkte
Vielfältige Forschungsvorhaben rund um die Herstellung, den Transport und die Anwendung von Wasserstoff stehen im Mittelpunkt der FuE-Arbeit des HySON-Institutes. Schwerpunkte sind u. a. Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudien, kombinierte Wasserstoff- und Sauerstoffnutzungen sowie die Entwicklung und Erarbeitung von Speicher- und Logistiklösungen.
Wasserstoff
Wasserstoff ist die sauberste Energiequelle und bietet als Energieträger eine Vielzahl von Vorteilen: Er ist in großen Mengen verfügbar, lässt sich direkt nutzen, und es entstehen bei der Nutzung keine CO2-Emmissionen. Im Vergleich zu anderen Energiequellen besitzt Wasserstoff einen sehr hohen Wirkungsgrad.